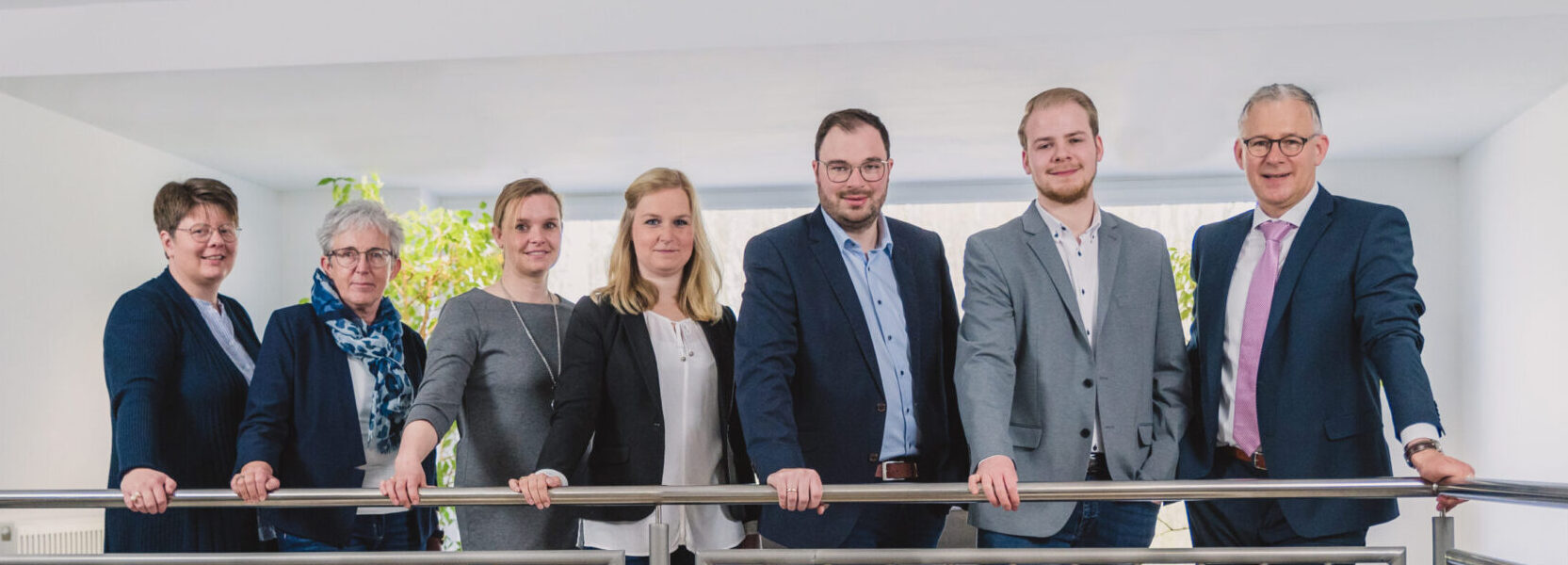Falscher Schuldiger: Warum das Ehegattensplitting nichts mit unserer Arbeitszeitkrise zu tun hat
In der aktuellen Debatte über angeblich zu geringe Arbeitszeiten in Deutschland wird ein alter Bekannter wieder hervorgeholt: das Ehegattensplitting. Regelmäßig ist zu lesen, dieses steuerliche Instrument halte insbesondere Teilzeitbeschäftigte davon ab, ihre Arbeitszeit auszuweiten. Nicht selten wird die Abschaffung des Splittings deshalb als Hebel für mehr Erwerbsarbeit präsentiert.
Diese These klingt eingängig. Sie ist nur leider falsch.
Wer das verstehen will, muss sich ansehen, was das Ehegattensplitting tatsächlich tut – und was nicht.
Rechtstechnisch ist das Splitting nichts weiter als eine Rechenvorschrift: Das gemeinsame Einkommen beider Ehegatten wird halbiert, diese Hälfte nach dem Grundtarif besteuert und das Ergebnis anschließend verdoppelt. Mehr steckt nicht dahinter. Kein Bonus, keine Prämie, keine Subvention.
Die Wirkung ergibt sich allein aus der Progression des deutschen Einkommensteuertarifs. Weil der Tarif mit steigendem Einkommen stärker zugreift, dämpft die rechnerische Halbierung des Einkommens die Progressionswirkung. Mathematisch ist ausgeschlossen, dass die Zusammenveranlagung zu einer höheren Steuer führt als zwei Einzelveranlagungen. Das ist keine politische Position, sondern eine zwangsläufige Folge der Tarifkonstruktion.
Das bedeutet im Umkehrschluss: Würde das Ehegattensplitting abgeschafft, stiege für betroffene Ehepaare zwangsläufig die Gesamtsteuerbelastung. Immer. Ohne Ausnahme.
Dabei wird häufig übersehen: Das Splitting zwingt niemanden. Ehegatten können bereits heute freiwillig die Einzelveranlagung wählen, wenn dies ihren wirtschaftlichen Interessen eher entspricht. Das Steuerrecht stellt also schon jetzt jene Wahlfreiheit bereit, die in der öffentlichen Debatte erst durch die Abschaffung des Splittings geschaffen werden soll.
Die Abschaffung würde daher keine neue Entscheidungsfreiheit eröffnen – sondern lediglich in den Fällen, in denen Ehepaare sich bewusst für die Zusammenveranlagung entscheiden, zu einer höheren Steuerlast führen.
Der Denkfehler der aktuellen Diskussion beginnt genau an dieser Stelle.
Kritiker argumentieren, der „Zweitverdiener“ werde durch das Splitting mit einem hohen Grenzsteuersatz belastet und habe deshalb geringe Anreize, mehr zu arbeiten. Dieses Argument basiert jedoch auf der theoretischen Annahme, Ehegatten entschieden arbeitsmarktpolitisch als zwei völlig unabhängige wirtschaftliche Akteure. Das Steuerrecht – und die Realität der meisten Haushalte – unterstellen jedoch das Gegenteil: Ehepaare wirtschaften gemeinsam und maximieren ihr gemeinsames verfügbares Einkommen. In dieser Haushaltsperspektive existiert kein isolierter „Zweitverdieneranreiz“. Maßgeblich ist allein das Gesamteinkommen und dessen Gesamtbelastung.
Und hier wird die Absurdität der Debatte sichtbar: Wie soll eine höhere steuerliche Belastung einen Anreiz für Mehrarbeit setzen? Wenn von einem zusätzlich verdienten Euro künftig mehr an den Fiskus fließt als zuvor, steigt nicht der Anreiz zu arbeiten – er sinkt. In der Arbeitsangebotsökonomie ist das kein kontroverser Befund, sondern ein elementares Prinzip.
Das Ehegattensplitting „belohnt“ keine Teilzeit. Es verhindert lediglich, dass zwei Einkommen so besteuert werden, als wären sie eines. Seine Abschaffung würde nicht dazu führen, dass mehr gearbeitet wird – sondern dazu, dass Arbeit höher besteuert wird.
Wer ernsthaft über Arbeitsanreize sprechen will, muss daher über Grenzsteuersätze, Sozialabgaben und Transferentzugsraten reden – nicht über eine tariftechnische Rechenmethode, die oft für etwas verantwortlich gemacht wird, das sie systematisch gar nicht leisten kann.
Das Ehegattensplitting ist kein arbeitsmarktpolitisches Instrument. Und seine Abschaffung wäre auch keines.